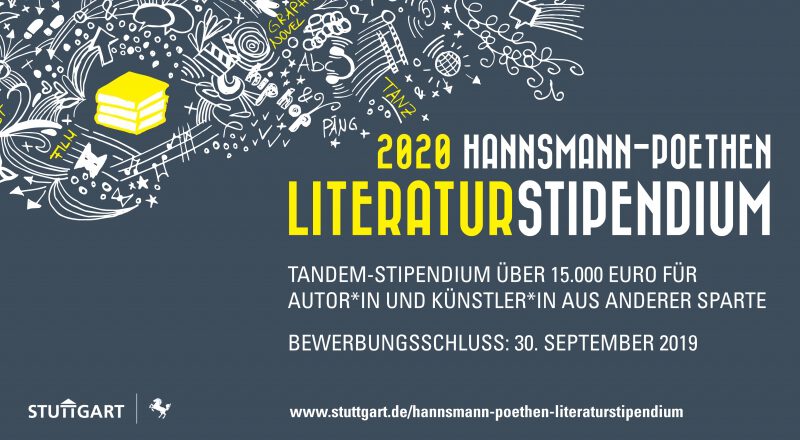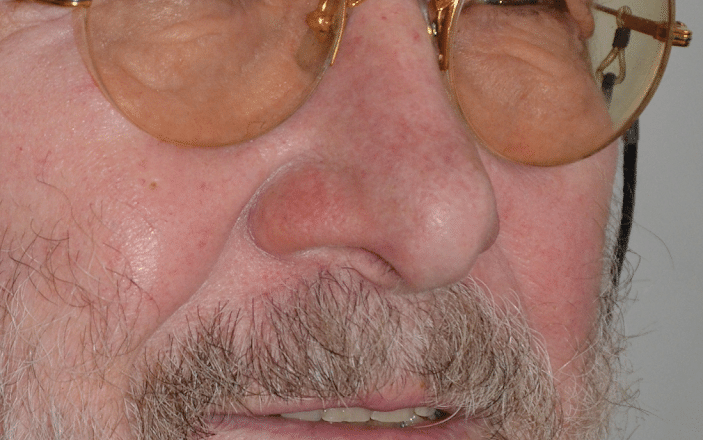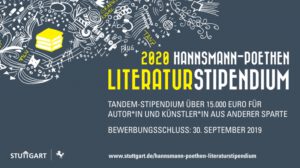 Zum dritten Mal schreibt die Landeshauptstadt Stuttgart das Hannsmann-Poethen-Literaturstipendium aus. Bewerben können sich Autorinnen und Autoren sowie Künstlerinnen und Künstler einer anderen Sparte (zum Beispiel Kunst, Musik, Theater, Film, Neue Medien, etc.), mit einem gemeinsamen literarisch-künstlerischen Projekt, das sie in Stuttgart umzusetzen planen. Bewerbungsschluss ist der 30. September 2019.
Zum dritten Mal schreibt die Landeshauptstadt Stuttgart das Hannsmann-Poethen-Literaturstipendium aus. Bewerben können sich Autorinnen und Autoren sowie Künstlerinnen und Künstler einer anderen Sparte (zum Beispiel Kunst, Musik, Theater, Film, Neue Medien, etc.), mit einem gemeinsamen literarisch-künstlerischen Projekt, das sie in Stuttgart umzusetzen planen. Bewerbungsschluss ist der 30. September 2019.
Das bundesweit einmalige Tandem-Stipendium umfasst 15.000 Euro, ein eigenes Wohn-/ Arbeitsstudio im GEDOK-Haus sowie zusätzlich ein Projektbudget in Höhe von maximal 9.000 Euro. Kriterien für die Vergabe sind die künstlerische Qualität und die spartenübergreifende Ausrichtung des zu realisierenden Projekts. Das Vorhaben soll zudem gesellschaftskritische Aspekte miteinbeziehen und neue Impulse für das kulturelle Leben schaffen.
Die Vergabe des Stipendiums erfolgt im Herbst 2019, der Aufenthalt der Stipendiatinnen und Stipendiaten in Stuttgart von Januar bis April 2020.
Bei der Premiere 2016 hatten die Autorin Gerhild Steinbuch und die Komponistin Jagoda Szmytka das Stipendium erhalten, 2018 ging es an die Autorin Lara Hampe und die Medienwissenschaftlerin Vera Sebert.
Alle Informationen zum Stipendium stehen auf der Website der Stadt Stuttgart, die ausführliche Ausschreibung mit sämtlichen Anforderungen ebenso.